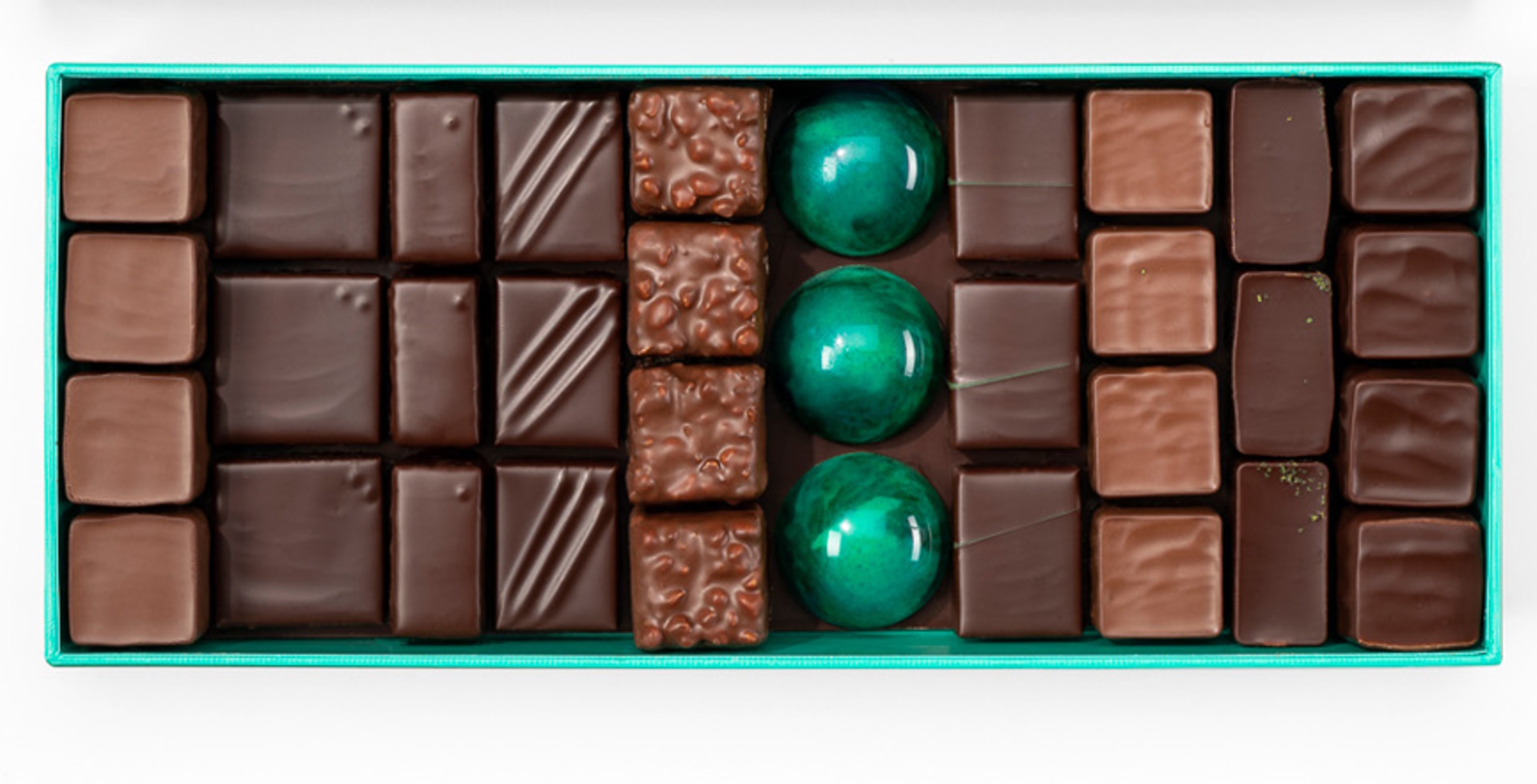Sie werden oft als verspielte Nebensächlichkeit wahrgenommen, dabei kann ihre Bedeutung für den Kochberuf gar nicht stark genug betont werden. Denn ganz unabhängig davon, ob man als Koch nun Kräuter prominent einsetzt oder sie unter dem Vorwand des radikalen Purismus meidet – sie sind und bleiben die wohl tiefliegendste Wurzel dieser Zunft. „Warum sind Ärzte Halbgötter in Weiß? Na weil es Köche schon länger gibt!“, sagt Thorsten Probost, 3-Hauben-Koch aus der Griggeler Stuba im Burg Vital Resort in Oberlech. Der Kräutermagier spielt damit nicht nur auf die ursprüngliche Verwendung von Heilkräutern an, sondern auch auf die weiße Uniform, die sich Arzt und Koch nicht bloß zufällig teilen. Die Foodindustrie jedenfalls hegt eine ungebrochene Faszination für all die Gräser, Blüten, Sträucher und Wurzeln dieser Erde – ob sie nun exotisch, gefährlich, verboten oder alles auf einmal sind. Doch welche dieser raren und exotischen Pflanzen stechen besonders hervor? Wie steht es um die (Il-)Legalität der heißen Ware der Zukunft? Und vor allem: Wie kann man sie heute verwenden?
Die Macht der Gewohnheit
Leuchtendes Beispiel für diese Sehnsucht nach dem Unbekannten ist das Unternehmen Koppert Cress aus dem niederländischen Ort Monster. Marcel Thiele, der Culinary Development Manager des Unternehmens, ist als Spice-Hunter in den entlegensten Winkeln unseres Planeten auf der Suche nach den exotischsten Produkten und weiß genau, wie diese in die Küchen der europäischen Spitzengastronomie gebracht werden. Ganz legal, versteht sich. Dass die administrativen Hürden für solche Prozesse nicht gerade weniger werden, davon weiß vor allem die Lebensmittelindustrie ein Lied zu singen. „Unter den heutigen Regelungen beispielsweise würde die Muskatnuss definitiv nicht mehr zugelassen werden“, so Thiele. „Schlicht und ergreifend deswegen, weil alle Gefahrenstufen bei einer Muskatnuss gegeben sind.“ Zur Erinnerung: Drei ausgewachsene Muskatnüsse reichen aus, um einen erwachsenen Menschen augenblicklich dahinzuraffen. Und diese drei Muskatnüsse gibt es frei im Handel zu kaufen. Was die Unmöglichkeit einer Zulassung in der heutigen Zeit betrifft, so bezieht sich Thiele dabei auch auf die Trocknung, die in den Ursprungsländern nicht garantiert werden kann. „Damit weiß man nie, ob eine Muskatnuss kontaminiert ist oder nicht, sobald sie beispielsweise aus dem Inselstaat Grenada oder aus Indonesien kommt.“ Konkret beschreibt Thiele das folgendermaßen: „Bricht man eine Muskatnuss auf oder schneidet man sie in der Mitte durch, sieht man da ein Muster – und damit Hohlräume. Eine Mandel ist im Gegensatz dazu ja aalglatt. Aufgrund des Fruchtfleisches der Muskatnuss können sich sogenannte Aflatoxine bilden, die wiederum gleichzeitig mit dem Wirkstoff aus der Muskatnuss, dem Myristicin, interagieren. Damit wird ein hochtoxisches Nebenprodukt geschaffen.“

Image: Roger Heil – stock.adobe.com
Akribische Feinarbeit
Eine solche kontaminierte Muskatnuss, die unwissentlich in oder über ein Gericht gerieben wird, versorgt ihren Konsumenten daher nicht nur mit ihrem charakteristischen süß-pfeffrigen Aroma, sondern auch mit einer verhängnisvollen Überdosis Gift. Umso wichtiger sei es daher, sagt Thiele, dass Köche sich regelmäßig an Experten wenden, wenn es um die Beschaffung und Verwendung von potenziell gefährlichen Produkten geht. Doch wie ist es zu erklären, dass die Muskatnuss dennoch so einfach erhältlich ist? „Eigentlich nur“, antwortet Marcel Thiele, „weil sie seit Jahrhunderten so bekannt und beliebt ist. Und natürlich ist die Muskatnuss nicht nur giftig. Ihr Aroma ist ja zurecht sehr beliebt.“
Thiele spricht damit einen zentralen Punkt an, wenn es um die Zulassung von Lebensmitteln und vor allem von Kräutern und Gewürzen geht. Möchte man ein exotisches Produkt in Europa offiziell zulassen, muss zuerst abgeklärt werden, ob das entsprechende Produkt im sogenannten europäischen Novel Food Catalogue aufscheint. „Dort werden alle Produkte und Pflanzenteile aufs Genaueste nach Regeln, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Kraft sind, geprüft. Scheint das exotische Produkt, das man nach Europa bringen will, nicht in dieser Datenbank auf, kann man ein Verfahren in Gang setzen.“ Was auf den ersten Blick nach endlos trockener Bürokratie klingt, muss es nicht unbedingt sein. Denn: „Das kann auch relativ schnell gehen“, versichert der kulinarische Schatzsucher. „Vor allem, wenn man anhand von Literatur, zum Beispiel aus Kochbüchern, beweisen kann, dass das Produkt in Europa bereits einmal Verwendung gefunden hat und es auch ohne Probleme konsumiert wurde. Dafür braucht es aber eine wahnsinnige Akribie in der Recherchearbeit. Da gilt es, sich zu vertiefen in Überlieferungen, Übersetzungen und so fort.“
Nur: Was tun, wenn man eine jener raren und exotischen Pflanzen in Europa bewilligen lassen möchte, die nie zuvor in Europa verkauft oder konsumiert worden sind und auch in keinem noch so ehrwürdigen Kochbuch Erwähnung finden? „Erst einmal muss man wissen, dass viele Pflanzen auf der Welt auch europäische ‚Abarten‘ haben“, so Thiele. Findet man also im hintersten Winkel der Erde ein schmackhaftes Pflänzchen, das das kulinarische Rüstzeug besitzt, um die europäischen Küchen zu erobern, ist der erste Schritt ein erstaunlich nüchterner: „Zuerst“, so Thiele, „muss man schauen: Gibt es in Europa ein Exemplar derselben Gattung, derselben Art oder Familie?“ Wenn ja, dann müssen sich erst einmal Toxikologen darum kümmern. Denn wie Thiele betont: „Eine Pflanzenart, die beispielsweise in Südafrika essbar ist, muss es noch lange nicht in Europa sein oder umgekehrt.“ Sobald eine Kräuterpflanze also nach Europa kommt, passt sie sich der Natur an und interagiert mit den Nachbarpflanzen, fügt sich ein ins neue Klima – und kann durch diese Modifizierungen auch Toxine bilden. Apropos: Wenn wir schon bei Toxinen und Pflanzen sind, drängt sich ein gewisses Grünzeug wie von alleine auf.
Plant-based, mal anders
„Warum ich Cannabis zum Kochen verwende? Weil ich glaube, dass pflanzliche Medizin von vielen Köchen nicht verstanden wird“, so Chris Sayegh. Der Cannabis-Koch aus dem liberalen Bundesstaat Kalifornien in den sonst nicht so liberalen USA macht aus THC und CBD subtile Protagonisten in seinen Gerichten. Zwar ist Sayegh bei Weitem nicht der Einzige im Golden State, der sein Einkommen mit Cannabis bestreitet – doch in der Fine-Dining-Szene einer der ganz wenigen und zweifelsohne der Bekannteste. 2012 kreierte Sayegh in privatem Kreis sein erstes Cannabis-Menü – damals noch illegal. Denn der Konsum des entspannenden Mary-Jane-Krauts ist im Golden State erst seit 2016 legal. Bezeichnend dabei ist, dass es sich durch die Legalisierung zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor der gesamten USA entwickelt hat. Der ökonomische Umfang des legalen Cannabismarkts wird in Kalifornien auf sage und schreibe sieben Milliarden Dollar geschätzt – was wiederum rund eine Milliarde an Steuereinnahmen bringt. „Was wir mit The Herbal Chef machen wollten, war, die Pflanzenmedizin in die Modern Cuisine zu bringen“, so der grasophile Küchenchef. „Mit Cannabis haben wir eine Methode gefunden, das auch umzusetzen. Die Philosophie dahinter lautet: Wir wollen zuallererst für eine tolle kulinarische Erfahrung sorgen. Das Essen an sich muss spektakulär sein. Das Ziel besteht darin, ganz unbescheiden gesprochen, dass wir mehr Gesundheit und Wohlbefinden in die Welt bringen“, proklamiert der Ganja-Guru selbstbewusst und unbescheiden.
Zurücklehnen und genießen
Konkret setzt Sayegh seine kulinarische Cannabis-Infusion vor allem durch Öle um. „Wir starten mit der Blüte, die kommt dann in ein Partner-Labor. Dort findet der Destillierungsprozess statt, wodurch letztlich ein konzentriertes Öl hergestellt wird. Damit versetze ich meine Gerichte.“ Doch Sayeghs Menü darf nicht mit einem Spacecake oder sonstigen pubertären Jugendkreationen verwechselt werden. Denn weder befinden sich so etwas wie angebratene Cannabis-Blüten auf dem Teller noch soll das Weed-Aroma im zehngängigen Menü vorherrschend sein. „Die Idee ist eigentlich, dass man das THC überhaupt nicht herausschmeckt. Punkt. Denn Cannabis ist ein extrem starkes, ja teilweise fast schon überwältigendes Aroma. Sehr grasig, erdig, bitter, wir wollen also nicht dieses Aroma alles übertünchen lassen.“ Zwar ändert sich das Menü von Sayegh oft, da er erstens vorwiegend saisonal und zweitens als gut gebuchter Gastkoch regelmäßig in Pop-ups in verschiedenen Städten aufkocht. Doch Evergreens wie eine Brioche mit Crème fraîche, in die das Cannabis-Öl injiziert wird, oder Escargots, die im leicht aromatisierten Öl gebraten werden, verdeutlichen, dass das berüchtigte Kraut beim Cannabis-Koch nicht mit der Holzkeule zubereitet wird. So unterschiedlich das zehngängige Menü auch jedes Mal ausfällt, eines bleibt gleich: Der Gast hat am Ende zehn Milligramm THC sowie zehn Milligramm CBD zu sich genommen.

Image: WindyNight – stock.adobe.com
THC, die Abkürzung für Tetrahydrocannabinol, ist nur eines von einer Vielzahl sogenannter Cannabinoide – also jener Stoffe, die in unterschiedlichen Konzentrationen in der Cannabispflanze vorhanden sind. Im Gegensatz zu CBD, also dem Cannabidiol, hat das THC durch das Andocken an CB1-Rezeptoren, die sich auf der Oberfläche der Nervenzellen des Menschen befinden, eine rauschähnliche Wirkung, die durch die Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin im Gehirn verursacht wird. Das CBD, der andere Hauptinhaltsstoff der Cannabispflanze, bevorzugt hingegen die CB2-Rezeptoren und löst daher auch keine rauschhaften Zustände aus, sondern wirkt schmerzlindernd und entkrampfend. „Das Menü ist von der Dosis her klar strukturiert“, so Sayegh. „In den ersten drei Gerichten bekommt man insgesamt fünf Milligramm THC. In die Gerichte Nummer neun und zehn kommen dann jeweils fünf Gramm CBD. Damit wird die Wirkung gleichmäßig verteilt und kommt nicht auf einen Schlag.“ Natürlich, so betont Sayegh, kann jeder Gast auf die Infusion der Wirkstoffe verzichten. Doch da die meisten den Herbal Chef eben deswegen besuchen, kommt das eher selten vor. „Durch das Essen von Cannabis kostet man im wahrsten Sinne des Wortes alle Nährstoffe optimal aus. Viel mehr, als wenn man es raucht“, so Sayegh. Der Cannabiskoch ist überzeugt, dass durch die zunehmende Enttabuisierung von Cannabis, die er in Kalifornien mit vorantreibt, die Zukunft auch andere Substanzen an den Herd bringen wird. „LSD ist sicher ein Kandidat“, so Sayegh. „Aber grundsätzlich geht es darum, Pflanzen als Lehrmeister anzusehen, die uns viel über unsere Psyche und unseren Körper beibringen können.“
Exotik der Alpen
Mit der zunehmenden Globalisierung werden virtuose Kräutergeschmäcke immer stärker mit exotischen Regionen in Verbindung gebracht. Doch dass man auch in unseren Breiten Kräuter zu wahren Protagonisten auf den Tellern erheben kann, hat in den vergangenen Jahren 3-Hauben-Koch Thorsten Probost aus der Griggeler Stuba im Burg Vital Resort in Oberlech auf bahnbrechende Art bewiesen. „Kräutern so viel Platz einzuräumen, ist natürlich etwas, das muss man wollen.“ Doch es geht nicht nur ums Wollen. Denn je ausgesuchter – und paradoxerweise: je heimischer! – die Kräuter, desto schwieriger ist es, sie in einer gastronomischen Küche auch in ausreichender Menge zur Verfügung zu haben. „Oft ist das gar nicht so leicht“, so der Kräuterkönig aus Oberlech, bevor er sein Programm erläutert. „Wir nehmen ja keine Gewürze, sondern Kräuter, die den Urgeschmack der Produkte transformieren. Das Salz kommt aus Oberösterreich, Pfeffer haben wir keinen – denn mein Pfeffer ist die Alpenaugenwurz“, so Probost. Dem Kümmel zum Verwechseln ähnlich, benutzt Probost den Samen dieses delikaten Alpengewächses für die sanfte, rauchige Schärfe, für die üblicherweise der Pfeffer benutzt wird. Doch auch von der Bachnelkenwurz schwärmt Probost. „Im Frühling, wenn sie bei uns in den Alpen blüht, gräbt man die Wurzel aus, putzt sie sauber und lässt sie trocknen. Sie kann dann vermahlen werden – und das ist dann der pure Wahnsinn, wenn man sie im Winter zum Blaukraut kocht!“ Und doch: So ganz ohne das exotische Elemente kommt selbst Probost nicht aus. „Vor allem im asiatischen Bereich gibt es ja eine Menge an Kräutern, die die Gesundheit unterstützen. Murdannia beispielsweise hilft nachweislich dabei, die Nebenwirkungen einer Chemotherapie zu erleichtern.“ Das Murdannia-Kraut wird dafür zuerst getrocknet, pulverisiert und das Pulver meist in Form von Kapseln verabreicht. Dass Probost die Pflanze in seine Kräuterküche integriert, überrascht da nicht weiter. „Ich nehme die leicht fleischigen Blätter weg, schneide sie in ganz dünne, feine Streifen und gebe sie in Salate. Das verleiht ihm eine sanfte, säuerlich-bittere Note.“ Thorsten Probosts detailreiche Kenntnisse und gekonnte Verwendung der Murdannia sind beispielgebend dafür, warum sich Koch und Arzt eine oft zum Verwechseln ähnliche Uniform teilen. Was Marcel Thiele in hippokratischer Manier mit folgendem Satz auf den Punkt bringt: „Brauche ich etwas zum Leben, gehe ich zum Koch. Brauche ich etwas zum Überleben, gehe ich zum Arzt.“