Kartoffeln aus dem Nachbarort, das Fleisch vom Bauer Alois nebenan: Als Matthias Tritsch 2015 mit der Familie im Allgäu Urlaub machte, fiel ihm auf, dass die Speisekarten in den Restaurants dort oft viel mehr Informationen enthielten als die in seiner niedersächsischen Heimat. „Wo immer wir aßen, fand sich am Ende der Karte eine lange Liste mit den Produzenten.“ Tritsch, ein Grafiker mit großer Freude am Kochen, kam ins Grübeln: Beim Einkaufen orientierte er sich an Herkunftsbezeichnungen und Siegeln. In Restaurants fehlte ihm diese Hilfestellung. Zurück in Lüneburg sprach er einen Freund, den Koch und Hotelier Marcus Ramster darauf an. Der war Mitglied in einem Verband für regionale Esskultur. Dessen Einfluss reichte jedoch kaum über die Lüneburger Heide hinaus. „Wir fragten uns: Kann man so etwas nicht bundesweit aufziehen?“
Noch im selben Jahr gründeten Tritsch und Ramster den Verein Greentable, eine gemeinnützige Initiative für mehr Nachhaltigkeit in der Gastronomie. Ihr Ziel: Mit einem eigenen Siegel Restaurants sichtbarer zu machen, die sich der Umwelt, dem Klima und ihren Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Denn davon gäbe es zwar etliche, sagt Tritsch. Aber die Betreiberinnen und Betreiber seien häufig nicht gut darin, ihr Engagement zu kommunizieren. Das Greentable-Siegel soll ihnen dabei helfen.
Ernährung? Zunehmend eine Frage der Haltung
Wachsende Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln, mehr Vegetarier, Tierwohl und Menschenrechte im Blick: Ernährung ist in Deutschland eine Haltungsfrage geworden. In einer aktuellen Studie der Otto-Group gaben 70 Prozent der Deutschen an, dass ethische Kriterien mittlerweile fester Bestandteil ihrer Konsumentscheidungen sind. Die Corona-Krise hat diesen Trend verstärkt. Es wurde mehr gekocht, häufig mit ökologischen Produkten. Im Pandemie-Jahr 2020 gaben die Deutschen über 20 Prozent mehr Geld für Bio-Lebensmittel und -Getränke aus als im Jahr zuvor. Auch die Gastronomie muss sich darauf einstellen, dass ihre Gäste künftig nachhaltiger genießen wollen.

Image: Greentable
- Lokal und saisonal
- Artgerechte Tierhaltung
- Nachhaltiger Fischfang
- Fairer Handel
- Abfallvermeidung
- Klimaschutz
- Reduce, reuse, recycle
- Ressourcenschonung
- Gesunde Ernährung
- Mitarbeiter-Fairness
- Soziales Engagement
- Transparenz im Dialog
Einige der aus dem Handel bekannten Siegel gibt es auch für Restaurants. Das grün gerahmte Bio-Sechseck für deutsche Produkte aus ökologischer Landwirtschaft zum Beispiel oder die Logos der Anbauverbände Demeter und Bioland. Diese bilden jedoch nur die Verwendung von Bio-Lebensmitteln ab und nicht, ob ein Betrieb zum Beispiel Ökostrom benutzt oder seine Leute angemessen bezahlt. Das seien aber wichtige Aspekte, sagt Matthias Tritsch. Sein Verein orientiert sich deshalb an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Bereiche wie erneuerbare Energien oder verantwortungsvoller Konsum stehen in der UN-Agenda nicht für sich, sondern greifen ineinander. Ein holistischer Ansatz, den Tritsch gerne auch in der deutschen Gastronomie sehen würde.
Zwölf Nachhaltigkeits-Kriterien
Restaurantbetreibende, die sich bei Greentable bewerben, erhalten einen Aufnahmeantrag. Dieser fragt zwölf Kriterien ab, die gemeinsam mit dem WWF und dem Institut für nachhaltige Ernährung (iSuN) der FH Münster entwickelt wurden. Vegetarische Angebote auf der Karte zählen ebenso dazu wie Müllvermeidung oder Leitungswasser als Mineralwasseralternative. Mindestens sechs dieser Kriterien muss ein gastronomischer Betrieb erfüllen. Erkennt er zudem den Kodex des Vereins an, darf er sich gegen eine Jahresgebühr mit dessen Siegel schmücken, erhält Werbematerialien und profitiert von der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins und dessen Auftritt in den Sozialen Medien.
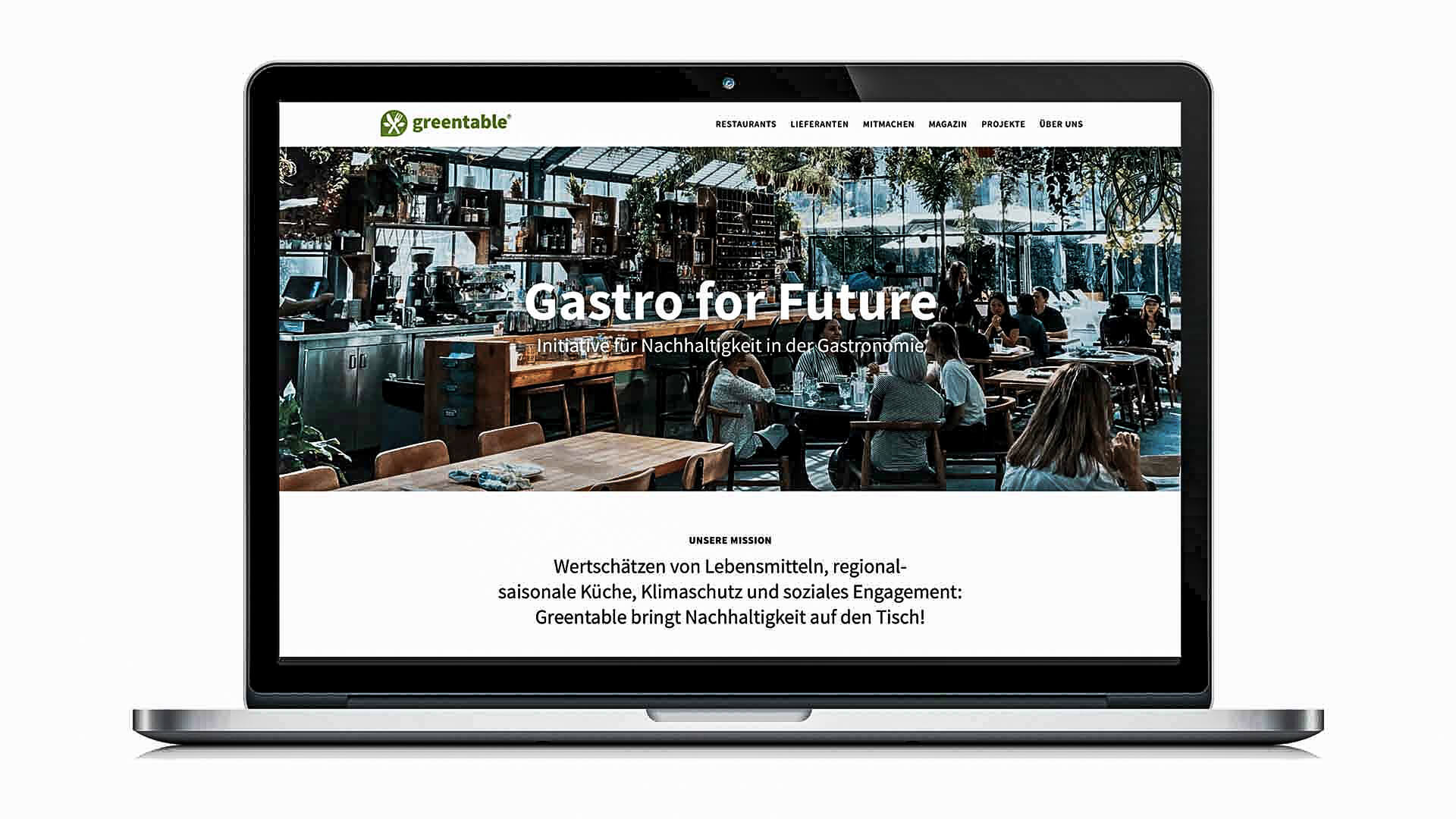
Image: Greentable
In der Regel ist es Matthias Tritsch persönlich, der die eingegangenen Unterlagen prüft, ob sie vollständig und die Angaben plausibel sind. In den sechs Jahren, die der Verein besteht, musste er erst zwei Betriebe ablehnen, sagt er: ein Restaurant, dessen Speisekarte absurd viele Gerichte umfasste und eine Großhandelskette, die nicht genügend Kriterien erfüllte. Ausgeschlossen wurde noch kein Teilnehmer. Melde sich ein Gast mit einem entsprechenden Hinweis bei ihm oder sei aus den Sozialen Medien ersichtlich, dass ein Betrieb sich nicht an die Nachhaltigkeits-Vereinbarung halte, fordere er jedoch zum Nachbessern auf, so Tritsch. „Wir haben auch einige freie Mitarbeitende, die sich stichprobenartig Restaurants anschauen, wenn sie in der Gegend sind.“ Um dafür Festangestellte zu beschäftigen, nähme der Verein bislang zu wenig ein: etwa 20.000 Euro jährlich. Auch deswegen handele es sich bei dem vergebenen Siegel nur um eine Auszeichnung und keine Zertifizierung, wie der Vereinsgründer betont.
Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit schärfen
Für eine Zertifizierung braucht es Prüferinnen und Prüfer, die jedes teilnehmende Restaurant besuchen und vom Einkauf bis zur Lagerung alles abklopfen. Das kostet. Für das aus Australien stammende EarthCheck-Siegel zum Beispiel, das neben Hotels auch Restaurants bewertet, fallen alle zwei Jahre 3.000 Euro an. Wer das weltweit anerkannte Umweltmanagementsystem Norm ISO 14001 einführen möchte, muss ebenfalls mit mehreren tausend Euro rechnen. Dazu kommt die Zeit für Antragstellung und kontinuierliche Dokumentation der vereinbarten Maßnahmen. Will ein Restaurant das Bio-Siegel neben ein Gericht auf die Karte drucken, muss es dafür die Herkunft sämtlicher verarbeiteter Zutaten nachweisen können. Kommen im Betrieb auch konventionell hergestellte Produkte in die Töpfe, müssen diese erkennbar gekennzeichnet und getrennt gelagert werden.
„Gerade für kleinere Betriebe ist das zu bürokratisch und zu teuer“, sagt Matthias Tritsch. Mit 60 bis 180 Euro Beitrag im Jahr und einmalig 100 Euro Aufnahmegebühr sind die Kosten für das Siegel vergleichsweise moderat. Wer eine Greentable-Auszeichnung beantragt, braucht zudem nichts an der Lagerung zu verändern und muss auch keine unangekündigten Kontrollen fürchten. Statt eines strengen Blicks wie er beispielsweise bei Hygienevorschriften oder anderen gesetzlichen Regelungen üblich ist, setzt Greentable vor allem auf den Goodwill und das Engagement der teilnehmenden Restaurants. Wem partout nichts an Nachhaltigkeit liegt, der bewirbt sich gar nicht erst, anstatt hinterher zu schummeln – vermutlich liegt Tritsch mit dieser Einschätzung sogar richtig.

Image: Greentable: Christian und Steffi Wolf (Burgerwolf)
Die meisten Anbieter von Zertifikaten tun sich eher schwer damit, überhaupt gewillte Betriebe zu finden. Bioland zum Beispiel listet 160 Partner aus Gastronomie, Hotellerie und Catering. Demeter hat bisher zehn Betriebe aufgenommen. Greentable zählt derzeit 230 Restaurants und Lieferanten zu seinen Partnern. Ein Kiosk in der Eifel ist darunter, ein bekanntes Berliner Sterne-Restaurant, ein Bio-Bistrot in Mecklenburg-Vorpommern, mehrere Mensen und Betriebskantinen aber auch die Filialen einer Burger-Kette. Die Arbeitsweisen dieser Betriebe mögen extrem voneinander abweichen. Auf potenzielle Gäste wirken sie Dank des Siegels jedoch erstmal alle gleich „grün“. Das liegt daran, dass Greentable jedes seiner zwölf Kriterien gleich stark gewichtet. So zahlt beispielsweise Leitungswasser auf der Speisekarte genauso viel auf die sechs zu erreichenden Punkte ein wie der Bezug von Strom, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammt.
Bio ist kein Muss
Wer genauer wissen möchte, was den jeweiligen Betrieb nun nachhaltig macht, muss auf der Webseite des Vereins nachschauen. Tritsch weiß, dass die Gleichgewichtung nicht optimal ist. „Als wir 2015 mit dem Siegel starteten, hatten wir noch 67 Kriterien“, sagt er. Diese abzuarbeiten sei den Gastronominnen und Gastronomen aber zu kompliziert. „Nach einem Jahr hatten wir erst zehn Mitglieder.“ Tritsch entschied sich fürs Downsizing.

Image: Greentable: Friederike Gaedke (Die Gemeinschaft e.V.), Micha Schäfer (Nobelhart und Schmutzig), Sebastian Frank (Horvath)
Manchen Gästen mag auch nicht bewusst sein, dass in einem Restaurant mit Greentable-Siegel nicht automatisch Bio-Lebensmittel serviert werden. Während das Bistrot in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise nachweislich Bio-zertifiziert ist und sich Greentable gegenüber verpflichtet, mindestens 30 Prozent Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft zu beziehen, verarbeitet die Burgerkette laut einer ihrer Pressemitteilungen nur „überwiegend regionale und saisonale Produkte“. Bio-Produkte kosten in der Anschaffung jedoch oft mehr. In vielen Fällen sind sie auch besser für die Umwelt als konventionelle – weniger Pestizide, nachhaltigere Bodenbewirtschaftung und größere Artenvielfalt. Tritsch möchte Bio-Zutaten dennoch nicht zur Voraussetzung für sein Siegel machen. „Manche Restaurants nutzen überwiegend ökologisch hergestellte Produkte, die aber kein Bio-Label tragen.“ Salatpflanzen aus dem eigenen Garten etwa oder auch Produkte von Bauernhöfen, die Umweltschutz sehr ernst nehmen ohne selbst zertifiziert zu sein.
Das große Ziel: gute, gesunde Lebensmittel
Neben Bio gibt es seit einigen Jahren noch einen weiteren Verbrauchertrend: regional. Bei Greentable können Restaurants punkten, deren Zutaten zu mindestens 50 Prozent saisonal und lokal produziert sind. „Lokal“ ist jedoch eine dehnbare Bezeichnung. Kurze Lieferwege sind zwar erstmal gut fürs Klima. Ein regionales Steak kann aber auch aus der benachbarten Fleischfabrik stammen. Matthias Tritsch räumt ein, dass Regionalität kein optimales Kriterium ist.
Dass die Greentable-Evaluierung nochmal angepasst wird, schließt er nicht aus. „Wir diskutieren die Kriterien immer wieder.“ In erster Linie ginge es ihm darum, das Bewusstsein der Gastronomie für mehr Nachhaltigkeit zu schärfen. Diese sei für die Betreiber und Betreiberinnen zwar immer unter den Top-Themen aber meist nur auf Platz zwei oder drei. „Mal geht die neue Hygieneverordnung vor, dann das Verbot von Einwegplastik oder der Fachkräftemangel und jetzt Corona.“

Image: Greentable
Greentable bemüht sich deswegen, mit eigenen Projekten voranzugehen. Seit 2015 hilft der Verein zum Beispiel mit der von ihm mitentwickelten Beste-Reste-Box, einer ökologischen Verpackung für Speisereste, Restaurants dabei Müll zu reduzieren. Und im September startete er den deutschen Ableger der US-Initiative Zero Foodprint: Teilnehmende Restaurants erhöhen die Preise für ihre Gerichte um ein Prozent. Mit dem so zusätzlich eingenommenen Geld unterstützt die Initiative dann regenerative Landwirtschaft – zum Beispiel mit mobilen Geflügelställen oder Bäumen für Agroforste, die den Boden zwischen den Feldern vor Austrocknung und Erosion schützen. „Während der Öko-Landbau vorrangig die Erhaltung anstrebt, zielen regenerative Praktiken auf Verbesserung und Wiederaufbau ab. Mithilfe von regenerativer Landwirtschaft sollen also Böden verbessert und Biodiversität erhöht und somit ursachenbezogen gewirtschaftet werden, anstatt reine Symptombekämpfung zu betreiben“, sagt Tritsch.















