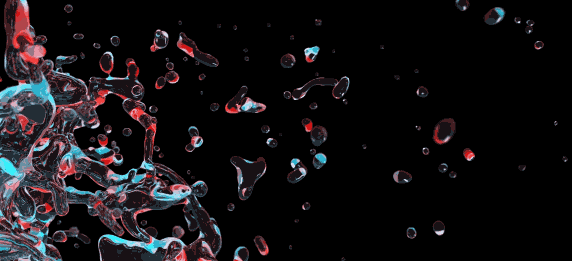Begriffliche Spitzfindigkeiten gehören bekanntlich zur Lebensmittelbranche wie Knoblauch in die Escargots: Von der berüchtigten Cassis-de-Dijon-Entscheidung in den 70ern bis hin zur semantischen Schwurbelei rund um vegane Burger und Soja-Drinks unterliegt das Geschäft mit dem Essen penibelsten Sprachregelungen, die bei Lebensmittelherstellern und Gastronomen gleichermaßen für regelmäßiges Kopfschütteln sorgen. Umso verwunderlicher ist es, dass es auch im Jahr 2020 noch kulinarische Fachbegriffe gibt, die genauso schwammig wie allgegenwärtig sind. „Aromen“, beispielsweise. Oder „Essenzen“, um ein noch extremeres Beispiel zu nennen. Gut, spricht ein hochtrabender Kritiker oder sprachaffiner Küchenchef von der „Essenz eines Gerichtes“, weiß man, was in etwa damit gemeint ist. Aber eine Essenz an sich?
Der weltberühmte und in seinem Einfluss kaum zu überschätzende Schöpfer der Grande Cuisine Auguste Escoffier definierte sie folgendermaßen: „Essenzen sind zu einem bestimmten Grad eingekochte Fonds mit ausgesprochen starkem Geschmack. Sie sind also nichts weiter als gewöhnliche Fonds, die mit viel weniger Flüssigkeit angesetzt sind, um auf diese Weise den Geschmack mehr zu konzentrieren.“ So steht es zumindest in seinem legendären Guide Culinaire, erschienen im Jahr 1903. Zugegebenermaßen überrascht Escoffiers Definition heutzutage doch ein wenig, denn bei aller Vagheit dieses Begriffes denkt heute der gemeine Foodie beim Wort Essenz eher an so etwas wie destillierte Tröpfchen, die man vorsichtig aus Pipettenfläschchen träufelt, um einem Gericht den letzten Aromenkick zu verpassen. Doch auch über 90 Jahre später änderte sich an dieser Definition nicht sonderlich viel. Hervé This-Benckhard, der mit seinem Mitte der 1990er-Jahre erschienenem Buch „Rätsel und Geheimnisse der Kochkunst naturwissenschaftlich erklärt“ ein Grundlagenwerk schuf, brachte es folgendermaßen auf den Punkt: „Eine Essenz erhält man, indem man einen gewürzten Sud oder eine Marinade reduziert.“ Etwas virtuoser und zeitgemäßer ist da schon der Duden: „Konzentrierte [alkoholische] Lösung meist pflanzlicher Stoffe, besonders ätherischer Öle.“ Bleibt die Frage: Gibt es dennoch einen Minimalkonsens, was eine Essenz in der Gastronomie genau ist? Wenn ja: Gilt er dann für Bars und Restaurants gleichermaßen? Wenn nein: Wo liegen die Unterschiede? Und überhaupt: Was kann man mit Essenzen alles anstellen?
Zucker statt Alkohol
„So richtig definiert im Lebensmittelrecht ist es ja nicht, was eine Essenz ist“, weiß Hariolf Sproll. In seiner Ulmer Bar Rosebottel stellt er seit Jahren publikums- und medienwirksam eine Vielzahl eigener Essenzen her. „Wobei das, was wir hier machen“, relativiert Sproll, „rein rechtlich gesehen die Bezeichnung Sirup trägt. Das liegt aber auch nur daran, dass wir die Haltbarkeit über Zucker erzielen. Ansonsten ist das im Vergleich zum Sirup vom Markt natürlich eine ganz andere Geschichte.“
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Die Sproll konkret folgendermaßen beschreibt: „Im Prinzip geht es darum, dem Produkt eine lange Ziehzeit zu geben. Nur dadurch schaffen wir es, aus einem Lebensmittel den Geschmack voll herauszuziehen. Wir stellen natürlich viele verschiedene Essenzen her. Je nachdem, dauert es zwischen zwölf und 96 Stunden.“ Anhand des wichtigsten Geschmacksträgers in Sprolls Essenzen-Reich – der Zitronenschale –, erklärt Sproll diesen langwierigen, geschmacksverdichtenden Prozess: „Zuerst wird die Zitronenschale in Zucker eingelegt. Dabei ist es wichtig, wirklich nur die Zeste und nicht auch den weißen Anteil der Schale, der nahe an der Frucht liegt, einzulegen. Denn die Zeste speichert am meisten Aromen, während der weiße Teil bitter schmeckt. Der Zucker zieht aus der Schale dann den Geschmack heraus.“ Nota bene: Sproll hat sich vorwiegend auf alkoholfreie Essenzen spezialisiert. Handelte es sich um eine alkoholische Essenz, würde die extrahierende Rolle des Zuckers hochprozentiger Alkohol übernehmen.
Aber zurück zur nullprozentigen Zitronenschale: „Die eingelegten Schalen bilden eine Flüssigkeit, das Ganze wird jetzt in Wasser eingelegt und auf 60 Grad erhitzt. Aber nur so lange, bis es diese 60 Grad erreicht hat, dann wird es auch gleich wieder ausgeschaltet. Daraufhin steht es 48 Stunden lang. Anschließend wird es gesiebt, eventuell werden weitere Zitrussäfte und noch einmal Zucker zugesetzt und auf knapp 70 Grad erhitzt. Die zweite Erhitzung dient vor allem der Haltbarkeit, vergleichbar mit der Pasteurisierung bei der Milch.“ Diese Prozedur ist gewissermaßen der Grundbaustein in Sprolls Essenzenmanufaktur. Klar, bei Tonic-Essenzen gibt es verschiedene Kräuteransätze mit unterschiedlichen Ziehzeiten, darunter solche, die zu intensiv werden, wenn es zu lange dauert. Wie aber verhält es sich mit hochprozentigeren Essenzen?

Image: AdobeStock | lilechka75
Vorsicht, nur tröpfchenweise
„Am Ende ist Alkohol ja ein Geschmackstreiber, wie Öl in der Küche beispielsweise“, sagt Fabian Heinßen, Verkaufsleiter für die Gastronomie in Norddeutschland von Thomas Henry. Im vergangenen Jahr brachte das Premium-Bitterlimonaden-Unternehmen aus Berlin drei Essenzen auf den Markt, die zusammen mit nationalen Bargrößen wie Karim Fadl, Michael Blair, Sven Riebel, Boris Gröner und Arun Naagenthira Puvanendran entwickelt worden sind: Waldmeister, Waldpilz und Sanddorn. „Um den klaren Geschmack so weit wie möglich herauszukristallisieren“, erklärt Heinßen, „muss Alkohol hinzugefügt und alles reduziert werden, sodass am Ende eine klare Aromatik da ist, die keinen Alkohol mehr drinnen hat. Ähnlich wie bei einer Jus: Wenn der Rotwein herunterreduziert ist, ist auch kein Alkohol mehr drinnen, aber der Geschmack ist um einiges intensiver und besser.“ Der Einsatz von Essenzen ist im Bar-Bereich zwar vielseitig, kann aber vor allem auf seine Vorteile im Filler-Bereich heruntergebrochen werden. „Einen Manhattan beispielsweise kann man super mit der Umami-Trüffel-Note des Waldpilzes kombinieren, Gin Fizz mit der feinen Säure der Sanddorn-Essenz und einen Whisky Sour kann man mit dem Waldmeister eine zusätzliche Komplexität geben.“ Wohlgemerkt: Im Gegensatz zu den alkoholfreien „Essenzen“ von Hariolf Sproll wird hier tröpfchenweise operiert: drei bis vier Tropfen auf 250 Milliliter, um genau zu sein. Es gebe auch Küchenchefs – zumindest in Hamburg – von denen Heinßen weiß, dass sie beispielsweise ihrer Pilzpfanne mit der Waldpilz-Essenz den letzten Aromenkick verleihen. Bewusst und aktiv für die Küche vermarktet würden die Essenzen bei Thomas Henry jedoch nicht. Dennoch stellt sich die Frage: Welche Rolle nehmen Essenzen heute in den Küchen der Spitzengastronomie ein?
Philosophie als Gleichmacher
„Die Essenz ist meistens eine angenehme Begleitung zu Fisch oder Fleisch“, sagt einer der Besten seiner Zunft: Bobby Bräuer aus dem Zweisterner Esszimmer in München. Er ist einer der wenigen, in dessen Menüs Essenzen explizit aufscheinen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Erbsenessenz, Kartoffelessenz, Zwiebelessenz und so weiter finden sich sowohl auf aktuellen wie auch auf weniger aktuellen Karten. In Bräuers Gourmettempel fungiert sie als Alternative zu einer Jus oder einer gebundenen Sauce mit Sahne oder Creme fraîche. „Darum“, erklärt Bräuer weiter, „macht eine Essenz die ganze Sache leichter und ist gleichzeitig sehr kräftig, reduziert und unterstützend. Im Sommer beispielsweise ist unsere Lavendelessenz zum Huhn eine sehr schöne Begleitung.“ Dabei wird sie angesetzt wie eine Jus, dann geklärt wie eine Consommé, und dann wird sie nochmal stark eingekocht. Erstaunlich daran: Für Bräuer wird eine Essenz in etwas größeren Mengen als eine Jus in einem Gericht verwendet. „Aber Vorsicht: Deswegen ist eine Essenz noch lange keine Suppe, dafür ist sie viel zu kräftig. Eine Essenz ist vielmehr ein Zwitter zwischen einer Suppe und einer Sauce. So könnte man es letztendlich beschreiben.“ Zu Bräuers gelungensten Essenzen zählt er selbst die Zwiebelessenz, die er zum Kaninchen aufsetzt. Wie für eine Jus braucht auch eine Essenz drei Tage Zeit – und sie ist mitnichten weniger aufwändig, wie Bräuers Erklärung beweist: „Zuerst kocht man mit Honig ein helles Karamell“, holt der Küchentüftler aus. „Danach gibt man in Streifen geschnittene Zwiebel dazu und karamellisiert sie, löscht sie mit etwas Essig ab und lässt sie reduzieren. Danach Weißwein hinzugeben und das Ganze erneut reduzieren lassen, bevor man es mit hellem Kaninchenfond aufgießt. Während es kocht, gebe ich noch etwas Orange dazu, das gibt dem Ganzen Frische. Jetzt lasse ich es nochmal durchkochen und gebe Gewürze dazu. Zu Zwiebel passt hervorragend indische Zimtrinde, die ist nicht so süß wie der normale Zimt, den wir hier verwenden, sondern hat eine gewisse Schärfe. Apfel passt auch gut dazu. Das alles wird jetzt drei bis vier Stunden in ganz leichter Hitze gekocht, anschließend passiert und durchgedrückt. Daneben gare ich Zwiebeln zusammen mit hellem Geflügelfleisch, meist Putenbrust, etwas Salz, Helles vom Lauch und Stangensellerie. Das ist jetzt meine Klärmasse, mit der kläre ich jetzt den ersten Zwiebelansatz, das Ergebnis: eine Zwiebelconsommé. So, das passiere ich jetzt und lasse es mehrere Stunden ziehen. Am dritten Tag mache ich einen neuen Ansatz mit karamellisierten Zwiebeln, die ich einfach nur noch etwas ziehen lasse. Das Ganze reduziere ich dann nochmal stark, passiere es erneut – und fertig: ich habe eine geschmacklich extrem kräftige Essenz, die gleichzeitig leicht ist.“
Von alkoholfreien de-jure-Sirupen über Waldessenzen bis hin zu texturiellen Zwittern – es scheint, als sei der Essenz-Begriff unendlich dehn-, oder besser: klärbar. Andererseits: Eines haben all die verschiedenen Zugänge gemeinsam: Sie konzentrieren Geschmack in ein Minimum an quantitativem Volumen. Und beweisen damit, dass sie im Grunde genommen gar keiner endlosen Beliebigkeit unterliegen, sondern dem philosophischen Essenzbegriff durchaus gerecht werden, der da im Duden lautet: „Das Wesentlich[st]e, wichtigster Punkt von etwas; Kern“.